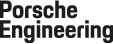)
Neues Batteriekonzept für Elektrofahrzeuge
Aus AC mach DC
Porsche Engineering hat das Konzept einer „Wechselstrom-Batterie“ für Elektrofahrzeuge entwickelt, die zahlreiche Komponenten in einem Bauteil vereint. Gesteuert wird sie von einem vereinheitlichten Steuergerätekonzept mit einer besonders leistungs- und echtzeitfähigen Rechnerplattform. Das System wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie entwickelt, am Prüfstand erprobt und in einem Fahrzeug demonstriert.
Das Antriebssystem von Elektrofahrzeugen besteht in der Regel aus getrennten Komponenten: einer Hochvoltbatterie mit Batteriemanagementsystem, einer Leistungselektronik zur Steuerung des Elektromotors und einem On-Board-Charger für das Laden mit Wechselstrom. Die Leistungselektronik wandelt die Gleichspannung der Hochvoltbatterie mithilfe eines Pulswechselrichters in die sinusförmige dreiphasige Wechselspannung für den Traktionsmotor um.
Dieser Aufbau hat sich in aktuellen Fahrzeugen bewährt, könnte sich aber künftig weiter verbessern lassen. „Der Trend in der Automobilindustrie geht in Richtung Hochintegration von Komponenten“, so Thomas Wenka, Fachprojektleiter bei Porsche Engineering. „Das eröffnet uns neue Möglichkeiten hinsichtlich Gehäusegröße, Gewichts- und Kostenreduzierung, Zuverlässigkeit und Effizienz.“ Das Entwicklerteam von Porsche Engineering hat die Hochintegration von Komponenten genutzt, um im Rahmen einer Machbarkeitsstudie in Wechselstrom-Batteriesystem zu entwickeln. Es integriert die normalerweise getrennten Funktionen des Batteriemanagement-Systems, des Pulswechselrichters und des On-Board-Laders in einer einzigen Komponente.
)
„Der Trend in der Automobilindustrie geht in Richtung Hochintegration von Komponenten.“
Thomas Wenka
Fachprojektleiter bei Porsche Engineering
Für die Studie haben die Entwickler von Porsche Engineering die Hochvoltbatterie des Elektroantriebs in 18 einzelne Batteriemodule, verteilt über drei Phasen, gegliedert. Diese lassen sich mithilfe von Leistungs-Halbleiterschaltern einzeln ansteuern. Die flexible Zusammenschaltung der einzelnen Batteriemodule zu einem Modularen Multilevel Series Parallel Converter (MMSPC) als verteiltes Echtzeitsystem ermöglicht eine dynamische Modellierung des Spannungsverlaufs, sodass die sinusförmige dreiphasige Wechselspannung für den Motor direkt aus der Gleichspannung der Batteriemodule erzeugt werden kann. „Mit dem MMSPC ist sowohl die direkte Ansteuerung des Elektro-Antriebsmotors beim Fahren als auch die direkte Anbindung ans Wechselstromnetz zum Laden der Batterie möglich“, erklärt Daniel Simon, Fachprojektleiter bei Porsche Engineering.
Zahlreiche technische Vorteile
Weitere Vorteile sind die einfachere Skalierbarkeit auf verschiedene Antriebsderivate sowie eine sicherere Handhabung der stromführenden Bauteile beim Service oder bei einem Unfall. „Dann wird der MMSPC ausgeschaltet, und das System fällt quasi auf seine Einzelmodule zurück, das heißt, es kann nur noch die Modulspannung gemessen werden“, so Wenka. Zudem steigt der Ausfallschutz bei einem möglichen Defekt einzelner Batteriezellen, da die intelligente Steuerung das betroffene Batteriemodul überbrückt. Somit ist die Realisierung einer sogenannten Limp-Home-Funktion zur nächstgelegenen Werkstatt mit reduzierter Leistung möglich. Mit einer konventionellen Batterie hätte dies das Liegenbleiben des Fahrzeugs zur Folge.
Auch bietet das Konzept der Wechselstrom-Batterie technisch das Potenzial einer höheren Schnellladefähigkeit durch gepulstes Laden. Eine große Herausforderung bei der Umsetzung des Wechselstrom-Batteriekonzepts war die Entwicklung eines leistungsfähigen und schnellen Zentral-Steuergeräts, das die einzelnen Batteriemodule exakt ansteuern kann. „Die dynamische Rekonfiguration der Batteriemodule beim Modellieren der Sinusschwingung wird durch das zugrundeliegende verteilte System ermöglicht, das unter allen Umständen Echtzeit-Anforderungen erfüllen muss“, sagt Simon. „Denn ein Zeitverzug beim Schalten der Module würde zu Defekten an den Batteriepacks und den zugehörigen Leistungselektroniken führen.“
Heterogene Multiprozessor-Plattform: Kombination aus Prozessoren und FPGA

Die Wechselstrom-Batterie wurde durch Hochintegration auf Systemebene zum Software-definierten Antriebsstrang. Die Besonderheit dieses Ansatzes: Klassische Hardware-Funktionen wie etwa der Pulswechselrichter, das Batteriemanagementsystem oder der On-Board-Lader im zentralen Steuergerät werden mit einem Prozessor-System softwareseitig umgesetzt (1). Die zusätzliche programmierbare Logik ist als FPGA implementiert. Das ermöglicht die Hardware-Beschleunigung des Algorithmus und gewährleistet die harte Echtzeitfähigkeit.
Die einzelnen Batteriemodule sind jeweils mit einer Leistungselektronik bestückt und in drei Phasen zur E-Maschine angeordnet (2).
Um aus einer Gleich- eine Wechselspannung zu erzeugen, werden die einzelnen Zellmodule der Batterie mithilfe der bestückten Leistungselektronik unterschiedlich verschaltet (3). Liegen alle Module parallel, ist die Spannung am geringsten (links). Sind sie hingegen alle in Reihe geschaltet (rechts), erreicht die Spannung ihren Maximalwert. Werte dazwischen werden durch unterschiedliche Kombinationen aus Parallel- und Serienschaltungen der Module erreicht (vereinfachte Darstellung). Die Ansteuerung der Module muss aus Sicherheits- und Effizienzgründen zeitsynchron erfolgen.
Ein Modul besteht aus Batteriezellen und der Leistungselektronik (4). Die Leistungselektronik besteht aus acht Leistungs-MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistors) je Zellmodul und ermöglicht durch die Architektur unterschiedliche Verschaltungskonfigurationen wie Parallel-, Reihen-, Bypass- und passive Schaltung.
Echtzeitfähige Rechnerplattform
Parallel zum Konzept der Wechselstrom-Batterie haben die Elektronikexperten von Porsche Engineering ein Steuergerät mit einer besonders leistungs- und echtzeitfähigen, einheitlichen und hochintegrierten Rechnerplattform entwickelt. Die einzelnen Funktionen der Wechselstrom-Batterie wie Motor- und Batteriemanagement sowie die Ladefunktion laufen auf ihr parallel. Die Steuergeräte-Plattform besteht aus zwei Elementen, einem projektspezifischen sogenannten Baseboard und einer projektunabhängigen Recheneinheit in Form eines System-on-Modules mit einheitlicher Schnittstelle zum Baseboard.
„Die Recheneinheit stellt eine heterogene Multiprozessor-Plattform dar und ist als einzelner System-on-Chip ausgeführt. Darauf sind ein Field Programmable Gate Array (FPGA) – ein integrierter Schaltkreis mit programmierbarer Hardware – für die Datensteuerung und Überwachung im Hinblick auf die Echtzeitfähigkeit des Systems und ein leistungsstarker Multi-Core-Prozessor für die Verarbeitung großer Datenmengen in einer Komponente zusammengefasst“, erklärt Simon. „Der FPGA kann aufwendige Berechnungen übernehmen, um den Prozessor zu entlasten, sowie fehlende Peripherie ergänzen, was wesentliche Vorteile hinsichtlich Skalierbarkeit und Flexibilität gegenüber der sonst üblichen reinen Mikrocontroller- Lösungen sind. Und über die Auswahl des Derivats innerhalb der System-on-Chip-Familie lässt sich die Leistungsfähigkeit von einfachen Steuergeräteanforderungen – etwa I/O-getrieben, Kommunikation- Gateway oder Leistungselektronik – bis hin zu komplexen ADAS-Systemen mit zusätzlicher GPU und Video-Codec- Anforderung skalieren.“
)
„Über den System-on-Chip-Ansatz mit CPU und FPGA ermöglichen wir die harte Echtzeitfähigkeit.“
Daniel Simon
Fachprojektleiter bei Porsche Engineering
Eine Besonderheit des Ansatzes ist die softwarefokussierte Umsetzung der Steuergeräte-Funktionen. „Ein Teil läuft auf einem Prozessor, welcher den FPGA für die schnelle Regelung sowie die optimale Schaltstrategie nutzt und schlussendlich alle Module synchron ansteuert. Dadurch wird die dynamische Rekonfiguration durch Software ermöglicht; damit das aber funktioniert, muss die Leistungselektronik auf den Modulen diese Schaltstrategie umsetzen“, so Simon. „Über den System-on-Chip-Ansatz mit CPU und FPGA ermöglichen wir die harte Echtzeitfähigkeit, die sich mit normalen Mikrocontrollern nicht realisieren lässt.“
Porsche Engineering hat das Konzept der Wechselstrom- Batterie zusammen mit der neuen Steuergeräte- Plattform in verschiedenen Prototypen umgesetzt und erfolgreich am Prüfstand getestet. Auch wurde das System in ein Testfahrzeug integriert, um die grundlegende Funktionsfähigkeit zu demonstrieren. „Für die Wechselstrom-Batterie war die Entwicklung der neuen Steuergeräte-Plattform zwingend notwendig. Da sie sich aber flexibel anpassen lässt, wurde daraus ein eigenständiges Projekt, das fortgeführt wird“, sagt Wenka. Bei neuen Projekten kann das System-on-Module und ein Teil der zugehörigen Software weiterverwendet und die Funktionalität des Baseboards einfach um die benötigen Hardwarefunktionen und Schnittstellen erweitert werden. Das Steuergerät lässt sich so flexibel an neue Anforderungen anpassen und eignet sich daher für alle Einsatzfälle, bei denen hohe Rechenleistung und Echtzeitfähigkeit benötigt werden und sich die Anforderungen während des laufenden Projekts noch ändern können. „Die projektunabhängige Kombination von System-on-Chip auf dem Systemon-Module des Steuergeräts kommt dadurch auch mit anderen komplexen Aufgaben gut zurecht, was es als Funktionsprototypen-Plattform zu einer guten Wahl für die Prototypenentwicklung macht“, erklärt Simon.
144
Vorteile gegenüber konventionellen Prototyp- Steuergeräten ergeben sich beispielsweise durch die schnellere Funktionsentwicklung: Die Hardware stellt hohe Rechenreserven zur Verfügung, außerdem kann bei einer Steuergeräteentwicklung bereits auf die Basissoftware und bestehende Software-Blöcke als sehr gute Absprungbasis aufgesetzt werden. „Derzeit ist geplant, die neue Steuergeräte-Plattform zunächst für die Prototypenentwicklung bei Porsche Engineering einzusetzen“, berichtet Wenka. „Grundsätzlich eignet sich das Konzept in leicht abgewandelter Form jedoch auch für Serienapplikationen.“
Info
Text erstmals erschienen im Porsche Engineering Magazin, Ausgabe 2/2024.
Text: Richard Backhaus
Copyright: Alle in diesem Artikel veröffentlichten Bilder, Videos und Audio-Dateien unterliegen dem Copyright. Eine Reproduktion oder Wiedergabe des Ganzen oder von Teilen ist ohne die schriftliche Genehmigung von Porsche Engineering nicht gestattet. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Kontakt
Sie haben Fragen oder möchten weitere Informationen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme: info@porsche-engineering.de